Konflikte gehören zum Leben. Manche entstehen leise, als innere Reibung, wenn Gedanken und Gefühle nicht zusammenpassen. Andere sind laut und sie werden sichtbar in Beziehungen, Teams oder Organisationen.
Beides fordert uns: innere und äußere Konflikte sind „Energie-Prozesse“, die etwas in Bewegung bringen wollen. Und genau da beginnt die eigentliche Arbeit im Coaching.
Viele Coaches reagieren reflexhaft: Sie suchen nach der passenden Methode, nach der „richtigen“ Frage oder nach einem schnellen Ausweg aus der Spannung. Doch Konflikte lassen sich nicht wegmoderieren. Sie gehen auch nicht von alleine weg, wenn man eine Weile wartet. Sie brauchen Raum, echtes Interesse und die Bereitschaft, die darunterliegende Dynamik zu verstehen.
Innere Konflikte entstehen, wenn etwas in uns nicht im Einklang ist: Werte gegen Bedürfnisse, Wollen gegen Sollen, Loyalität gegen Selbstfürsorge.
Äußere Konflikte entstehen, wenn diese inneren Spannungen aufeinandertreffen, z.B. in Partnerschaften, Teams oder Organisationen.
Wenn du hier als Coach wirksam begleiten willst, braucht es mehr als ein paar Methoden und einige gute Fragen. Du brauchst die Fähigkeit, zuzuhören, wahrzunehmen und auszuhalten.
Gutes Konfliktcoaching beginnt nicht mit Technik, sondern mit Haltung. Es braucht Bewusstheit, Klarheit und die Fähigkeit, Spannung nicht als Störung, sondern als Information zu verstehen. Denn Konflikte zeigen, wo Entwicklung ansteht, beim Klienten, im System, und manchmal auch bei dir selbst.
Und genau deshalb ist es so entscheidend, dass du als Coach innerlich aufgeräumt bist.
Wenn du deine eigenen ungelösten Themen oder persönlichen Trigger in den Prozess einbringst, verlierst du Klarheit. Du fängst an, unbewusst zu lenken, statt zu begleiten.
Professionelles Konfliktcoaching bedeutet, die eigene Geschichte zu kennen, sie draußen zu lassen und präsent zu bleiben. Nur wer innerlich sortiert ist, kann neutral führen. Und nur wer sich selbst gut kennt, kann andere sicher durch ihre Konflikte begleiten.
1. Höre aktiv zu und zeige Empathie
Aktives Zuhören heißt nicht einfach nicken und zusammenfassen. Es heißt, wirklich präsent zu sein und zwar emotional, gedanklich, körperlich. Du hörst nicht nur, was deine Klientin sagt, sondern spürst, was mitschwingt. Du zeigst Empathie, selbst wenn du die Sichtweise deines Gegenübers nicht teilst. Genau da zeigt sich Professionalität: Du musst nichts gutheißen, um es zu verstehen. Und denke dran: Verstehen heißt noch lange nicht einverstanden sein.
2. Nimm aufmerksam wahr
Hör nicht nur die Worte, sondern nimm wahr, was darunter liegt. Zwischen den Zeilen liegen oft die wahren Themen: Angst, Enttäuschung, das Bedürfnis nach Kontrolle oder Anerkennung. Deine Aufgabe ist, das zu spüren und nicht um zu interpretieren, sondern um zu verstehen.
Vertraue deiner Intuition. Wenn du merkst, dass etwas nicht stimmig ist, sprich es an. Nicht als Vorwurf, sondern als Einladung zur Klärung.
3. Bleib neutral
Neutralität heißt nicht, emotionslos zu sein. Es heißt, innerlich klar zu bleiben, auch wenn das Gespräch emotional wird. In Konflikten ist die Versuchung groß, Partei zu ergreifen, und das passiert bewusst oder unbewusst. Doch sobald du dich auf eine Seite stellst, verliert der Prozess seine Klarheit.
Deine Neutralität schafft Vertrauen. Sie macht es möglich, dass beide Seiten sich öffnen können.
Und ja, das heißt auch, deine eigenen Trigger zu kennen. Wenn du selbst konfliktscheu bist oder Harmonie suchst, wirst du dazu neigen, Spannungen zu glätten. Deine Aufgabe ist nicht, zu beruhigen. Deine Aufgabe ist, Raum zu halten.
4. Erkenne und verstehe Konfliktdynamiken
Konflikte sind selten das, was sie auf den ersten Blick scheinen. Hinter jedem Streit oder Auseinandersetzung steht ein System von beispielsweise Erwartungen, unausgesprochenen Bedürfnissen, Regeln oder alten Mustern.
Wenn du Konflikte coachst, solltest du diese Dynamiken erkennen:
- Wer hat (bewusst oder unbewusst) die Deutungshoheit?
- Welche unausgesprochenen Bedürfnisse stehen im Raum?
- Auf welcher Kommunikationsebene bewegen sich die Beteiligten?
Wenn du das Muster siehst, kannst du gezielt intervenieren. Wenn nicht, drehst du dich im Kreis, mit schönen Fragen, jeodch ohne Wirkung.
5. Hab eine Methodenvielfalt und nutze sie flexibel
Konflikte sind so unterschiedlich wie Menschen. Deshalb brauchst du ein breites Repertoire, um flexibel zu reagieren: Mediationsansätze, klärende Fragen, Skalierungen, kreative Interventionen.
Was zählt, ist nicht die Methode selbst, sondern deine Fähigkeit, sie bewusst einzusetzen.
Eine einfache Rating-Skala („Wie stark ist dein Ärger gerade, auf einer Skala von 1 bis 10?“) kann helfen, wenn du sie im richtigen Moment nutzt. Methoden sind keine Rettungsanker. Sie sind Werkzeuge und sie wirken nur, wenn du sie mit gezielt einsetzt.
6. Unterstütze bei tragfähigen Lösungen
Ziel des Konfliktcoachings ist nicht, dass sich jemand „besser fühlt“ oder dass Harmonie hergestellt wird. Ziel ist, dass alle Beteiligten zu tragfähigen, ehrlichen und nachhaltgen Lösungen kommen, die verstanden und getragen werden, nicht nur akzeptiert.
Das heißt: Nicht Symptome glätten, sondern Ursachen klären.
Nicht Schuld suchen, sondern Verantwortung.
Nicht Frieden erzwingen, sondern Bewusstsein schaffen.
Eine gute Lösung entsteht nicht am Flipchart, sondern im Gespräch – in dem Moment, in dem Menschen sich wirklich zuhören.
Dabei ist wichtig zu unterscheiden, welche Art von Konflikt du begleitest:
- Innere Konflikte erfordern Selbstklärung. Hier unterstützt du deinen Klienten dabei, gegensätzliche Bedürfnisse, Werte oder Loyalitäten zu erkennen und in ein stimmiges Verhältnis zu bringen. Du arbeitest weniger moderierend, sondern prozessbegleitend, förderst Selbstwahrnehmung und Entscheidungsfähigkeit. Ziel ist, dass dein Klient wieder in Einklang mit sich selbst handeln kann.
- Äußere Konflikte, also Gespräche mit zwei oder mehreren Konfliktparteien verlangen eine andere Haltung und Struktur. Hier brauchst du klare Prozessführung, methodische Flexibilität und absolute Neutralität. Deine Aufgabe ist, Verständigung zu ermöglichen, Perspektiven sichtbar zu machen und den Raum so zu halten, dass auch Unangenehmes ausgesprochen werden darf, ohne zu eskalieren.
Du führst nicht den Inhalt, du führst den Prozess.
In beiden Fällen gilt:
Konfliktcoaching ist kein Reparaturservice für Beziehungen, sondern ein Entwicklungsraum für Bewusstsein.
7. Bleib bei dir
Konfliktcoaching fordert dich heraus. Emotional, kognitiv, manchmal auch körperlich.
Wenn du innerlich unruhig wirst oder spürst, dass dich ein Thema triggert, ist das kein Fehler. Es ist ein Signal, dass du du ernst nehmen darsft. Bleib bei dir, atme und sortiere dich innerlich, bevor du sprichst.
Deine Stabilität ist das Fundament, auf dem deine Klientin sich sicher bewegen kann. Nur wenn du in deiner Mitte bleibst, kannst du auch im Sturm führen.
Konflikte sind weder Makel noch Scheitern und schon gar keine Störung. Sie sind Prüfsteine für Klarheit, Haltung und Beziehung. Als Coach zeigt sich in ihnen, wie stabil du wirklich stehst: ob du Spannung aushältst, ohne dich zu verlieren, ob du Raum gibst, ohne zu kontrollieren, und ob du präsent bleibst, auch wenn es unangenehm wird.
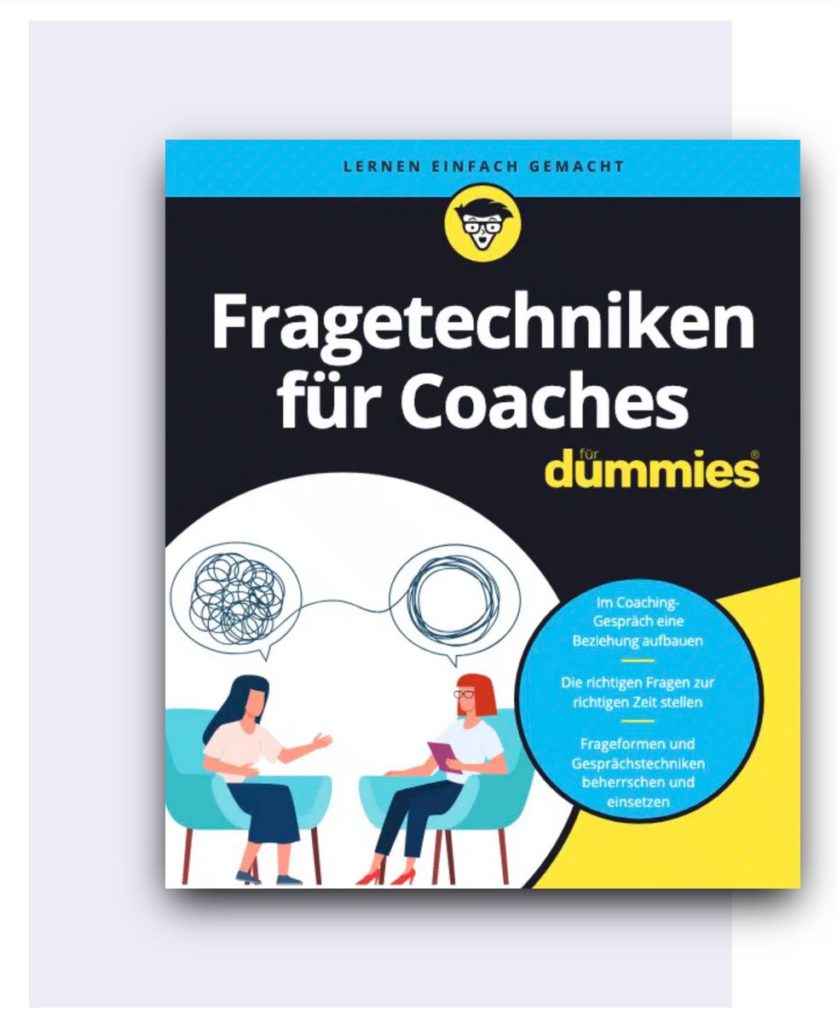
Mein neues Buch ist am 6. August erschienen und wurde schon über 1000 Mal verkauft. Genau richtig für dich, wenn du deine Fragetechnik verbessern willst.


0 Kommentare